
Fast jeder Journalist hat das schon erlebt: Am Ende fragt der Gesprächspartner, ob er den Beitrag vor Veröffentlichung lesen darf. Die wenigsten verstehen, dass das ein Angriff auf die Pressefreiheit ist. Hinzu kommt: In „infizierten“ Zeiten wie diesen, wo neue Ereignisse manches Gespräch rasend schnell eingeholt haben können, ist die Revision ein Zeitaufwand, der ein Interview am Ende ad absurdem führen kann.
Von Andreas Steidel
Es war bei der Landsgemeinde in Appenzell in der Schweiz. Das ist jenes direkte Demokratiespektakel, bei dem die Bürger die Hand und den Säbel heben. Für Ausländer ist das ein einzigartiges Erlebnis und ein nicht leicht zu durchschauendes Prozedere. Danach gab es Gelegenheit, mit dem Landammann zu sprechen, dem Vorsitzenden der Landsgemeinde. Der hörte sich alle Fragen geduldig an und sagte am Ende: „Da bin ich ja mal gespannt darauf, wie Sie als Außenstehender das wahrgenommen haben.“ Es ist jene Resonanz, von der man als Journalist eigentlich träumt. Der andere ist nicht argwöhnisch, sondern schlicht neugierig. Statt eine Berichterstattung in die Kategorien richtig oder falsch zu unterteilen, interessiert sich jemand dafür, wie etwas auf Menschen wirkt, die keine Insider sind.
Respekt vor der Freiheit des Wortes
Natürlich hat der Mann mit dem weiten Horizont am Ende des Gespräches auch nicht gefragt, ob er den Beitrag vor Veröffentlichung „Korrekturlesen“ kann: Der Respekt vor der Freiheit des Wortes war für ihn selbstverständlich, die Sichtweise eines medialen Beobachters schien ihm eher eine Bereicherung zu sein als etwas, vor dem man sich fürchten müsste.
Leider ist das nicht immer so. In allzu vielen Fällen enden anfänglich gute Gespräche mit dem Satz: „Schicken Sie mir das vor Veröffentlichung noch einmal zu?“ Gerne wird, wenn der Journalist oder die Journalistin sprachlos darauf reagiert, das Argument nachgeschoben: „Das ist nur, um Fehler zu vermeiden. Sie glauben nicht, was alles falsch geschrieben wird.“
Tatsächlich wird in den Medien manches falsch wiedergegeben, doch das Gros der Verfälschungen rührt daher, dass zu viel von der Wirklichkeit verschwiegen und zu wenig Klartext gesprochen wird. Wer seinen Gesprächspartnern vor Veröffentlichung den Artikel zum Gegenlesen gibt, riskiert jedoch genau das: Dass sie Kontroverses und Pointiertes herausstreichen, und Aussagen, die sie einst in aller Deutlichkeit getroffen haben, wieder zurücknehmen.
Die Sache mit den Zitaten
Die wenigsten verstehen, dass die Frage nach dem Gegenlesen den Kern des journalistischen Arbeitens betrifft. Es geht um die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit des Wortes. Die sehen viele ja durch Putin und Erdogan gefährdet und sind dann bass erstaunt, dass auch solche Einflussversuche nichts anderes sind, als ein Angriff auf die Pressefreiheit.
Überdies belasten sie das Verhältnis zu den Medien nachhaltig. Das ist vor allem für diejenigen schlecht, die mit ihnen regelmäßig zu tun haben, Pressesprecher oder Agenturen zum Beispiel. Wer in aller Penetranz versucht, vorher gegenlesen zu dürfen, der wird vielleicht zähneknirschend einen Faktencheck oder die Zitate zum Autorisieren bekommen. Aber man wird ihn (oder sie) kein zweites Mal anrufen.
Die Zitate sind ein weiteres interessantes Thema. Tatsächlich ist es in der deutschen Medienlandschaft üblich, Wortlautinterviews autorisieren zu lassen. Das ist die große Ausnahme von der Regel und hat im Print auch seine Berechtigung, weil ja nur selten Gesprächsprotokolle abgedruckt werden.
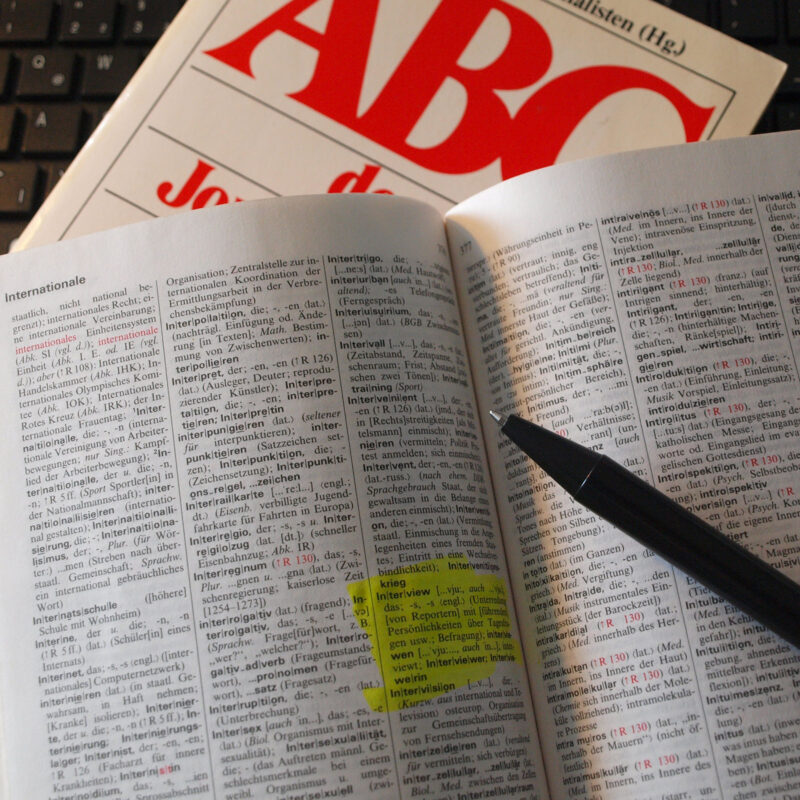
Alles wird immer komplizierter
Eine Unterform der Interview-Autorisierung ist die Autorisierung von Zitaten im Fließtext. Auch das ist noch im Rahmen des Zulässigen, führt jedoch zuweilen zu fragwürdigen Veränderungen: Da werden einst flott formulierte Aussagen wieder zurückgenommen. „Damit es professioneller klingt“, lautete das Argument einer Tourismusverbandsvorsitzenden. Tatsächlich klang es danach vor allem bürokratischer, ein Bärendienst für den Leser und den Journalisten, der nun obendrein sehen muss, wie er inhaltlich mit dem veränderten Wortlaut zurechtkommt.
Auch das ist den meisten, die gegenlesen wollen, nicht bewusst: Dass damit die Abläufe durcheinandergeraten, dass alles unglaublich kompliziert wird und einer Abstimmung bedarf, für die man weder Zeit noch Nerven hat.
Überdies stellt sich die Frage, was man als Journalist mit den „Korrekturen“ des Gegenlesers anfängt: Geht es nur um den falsch geschriebenen Vornamen, ist das kein Problem. Aber was, wenn Fakten herausgestrichen werden, weil sie dem anderen unangenehm sind? Oder der Versuch gestartet wird, eine Marketingschreibweise durchzusetzen, die die Regeln der deutschen Sprache missachtet („brauWelt“)?
Medien leisten leider Vorschub
Im ungünstigsten Fall führt auch das wieder zu einem unerfreulichen Hin und Her, hinter dem letztlich die Frage steckt: Wer hat eigentlich die Kontrolle über den Text? Die Antwort darauf ist im Grunde ja nicht schwer: Wer bezahlte Werbung macht, darf über den Inhalt bestimmen, wer Presseauskunft gibt, nicht.
Dass manche das nicht auseinanderhalten können, liegt allerdings auch an den Medien selbst: Immer häufiger gibt es Mischformen, in denen Werbeinhalte und redaktionelle Beiträge nicht mehr voneinander getrennt werden. Advertorials zum Beispiel, die letztlich nichts anderes als eine bezahlte Anzeige sind, aber wie eine redaktionelle Veröffentlichung daherkommen.
Kein Wunder, dass manche aus solchen Darstellungsformen ein generelles Zugriffsrecht ableiten. Ähnlich problematisch ist es, wenn Veröffentlichungen mehr oder weniger deutlich von der Schaltung einer Anzeige abhängig gemacht werden. Da wird man dann kaum nein sagen können, wenn das Geschäft an Bedingungen inhaltlicher Art geknüpft ist.
Dreiste Behauptungen
Darüber hinaus kommt es auch vor, dass Journalistinnen und Journalisten aus lauter Unsicherheit ihren Beitrag selbst zum Gegenlesen anbieten. Mit der Folge, dass ab und zu der erstaunliche Satz fällt: „Ihre Kollegen machen das aber alle.“ Frei nach dem Motto: Man kann es ja mal behaupten und hoffen, dass der andere einknickt.
Letztlich bleibt die Tatsache: Ein journalistischer Beitrag ist kein Schulaufsatz, den der Lehrer am Ende korrigiert, sondern ein Stück freie Meinungsäußerung, die keiner Zensur bedarf. Alle Beteiligten sollten ein Interesse daran haben, dass das auch weiter so ist. Nur so bleibt die Glaubwürdigkeit erhalten, die schließlich das höchste Gut einer jeden unabhängigen Publizistik ist.

Eigentlich stimme ich (als Journalistin) mit dem Artikel völlig überein. Allerdings kenne ich die Situation auch andersherum und habe fürchterliche Interviews erlebt bzw. hinterher gelesen, voller Fehler und (wahrscheinlich unabsichtlicher) Verdrehungen, die damit für mich geradezu rufschädigend waren. Das übrigens in durchaus etablierten Medien. Ich kann daher gut verstehen, dass man nach einem Interview noch einmal schauen möchte, was man denn angeblich so gesagt hat.
Ich kann dem nicht zustimmen, ganz und gar nicht. Vorher lesen und eventuelle Falschaussagen richtigstellen hat mit Zensur absolut nichts zu tun. Um zensieren zu koennen muss man Macht ueber den Zensierten haben. Habe ich die? Wow, da bin ich also ein Machthaber oder gar Diktator.
Freundliche Gruesse….