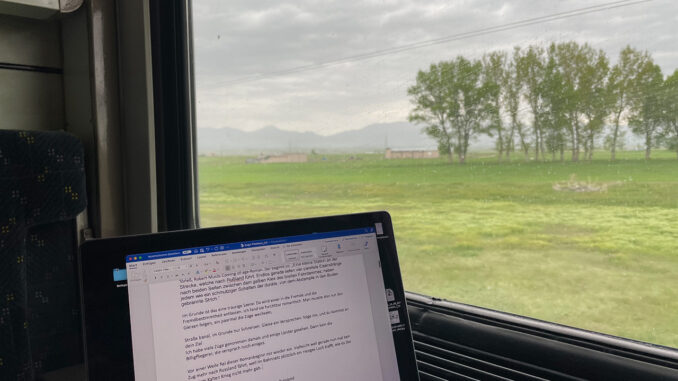
Die Bahn ist das Fortbewegungsmittel der Stunde. Wie weit bringt sie einen, wenn man einsteigt und einfach immer weiterfährt?
Von Michael Allmaier
Zugfahren ist schon seit Langem so ein Fimmel von mir. Als junger Mann las ich den Törleß, Robert Musils zeitlosen Coming-of-Age-Roman. An die ersten Sätze erinnere ich mich bis heute: »Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Russland führt. Endlos gerade liefen vier parallele Eisenstränge nach beiden Seiten zwischen dem gelben Kies des breiten Fahrdammes; neben jedem wie ein schmutziger Schatten der dunkle, von dem Abdampfe in den Boden gebrannte Strich.« Man soll diese Szene beklemmend finden; Törleß wird in die Fremdbestimmung entlassen. Bei mir bewirkte sie das Gegenteil. Ich wollte dahin! Denn dieser Ort war nicht trostlos: Er hatte ja Bahnanschluss. Man kam also jederzeit von dort weg, und vor allem – überallhin. Die Stränge verbanden ihn mit Russland und einem ganzen Kontinent.

Die Bahn, so würde ich das heute sagen, ist ein soziales Netzwerk. Eins der ersten, die wir erbauten, und bis heute das erstaunlichste: Es befördert nicht bloß Stimmen oder Bilder, sondern den ganzen Menschen. Damals, etwa zur Wendezeit, war das Wort noch nicht parat. Da merkte ich bloß, diese Gleise geben Reisenden ein Versprechen: Wir bringen dich an dein Ziel. Und du musst nichts weiter tun, als hier und da umzusteigen. Andere kauften damals ihr erstes Auto, ich Kursbücher und Bahnfahrkarten. So habe ich ein bisschen was gesehen von der Welt.
Zu Musils Zeit, vor rund hundert Jahren, standen Lokomotiven noch für die Zukunft. Doch schon damals begann in Deutschland der Rückbau des Streckennetzes, das um 1910 doppelt so dicht war wie heute. Der Betrieb verschlang Geld; und man brauchte Platz für Straßen. Selber fahren, Gas geben, das wurde zum Symbol der Freiheit, erst in der Wirtschaftswunder-BRD, nach der Wende dann auch im Osten. Kommunen rangelten nicht mehr um Fernbahnhöfe, sondern um Autobahnanschlüsse und zuletzt: Regionalflughäfen. Es war die Zeit der Billigfliegerei, die noch mehr versprach als das Bahnfahren, und auch ich fiel darauf herein.
Mochten die Züge schneller werden, im Ansehen fielen sie immer weiter zurück. Ein Verkehrsmittel von vorgestern, okay für Pendler und alte Leute. Ich kannte aber keinen mehr, der zum Spaß in ihnen reiste.
Nun, im Zeichen des kippenden Klimas, kommt die Eisenbahn zurück, gerade bei den Jungen. Im vergangenen Jahr wurden in Europa 600.000 Interrail-Pässe verkauft, mehr als jemals zuvor. Influencer fotografieren sich in Nachtzugabteilen. Abiturienten planen statt der workation in Neuseeland jetzt eine Odyssee auf Schienen vom Nordkap ans Mittelmeer. Und ich kann endlich mal auftrumpfen: »Kenn ich doch«, »War ich schon«. Was junge Leute eben gern hören.
Und dann gibt es da noch die beiden Klimakleber, die im Februar von der Bild-Zeitung an den Pranger gestellt wurden, weil sie es gewagt hatten, nach Bangkok zu fliegen. Interessant fand ich, wie die beiden sich verteidigten: Sie hätten lange nach Zügen gesucht, die sie an ihr Traumziel brächten. Bloß sei das dieser Tage einfach zu unsicher. Für die meisten Leute muss das wie die faulste aller Ausreden klingen. Ich hatte beim Lesen wieder so einen Törleß-Moment.
Die Eisenbahn, so dachte ich, hat uns in die Moderne geführt – erst mit dem Verladen von Kohle und Erz, dann mit einer ungeahnten Erleichterung des Reisens. Und sie hätte auch das Zeug, uns wieder hinauszuführen, weg von der überholten Idee, jeder Bürger brauche seinen Privatantrieb. Ich kann heute per Bahn in zehn Stunden von Berlin nach London reisen. Warum also nicht bis nach Bangkok? Technisch wäre das absolut machbar; die Schienen sind verlegt. Es würde auch nicht länger dauern als eine Atlantik-Überquerung per Kreuzfahrtschiff. Das Problem liegt woanders: Mindestens sieben Staaten müssten sich darauf verständigen, dass das eine gute Idee ist. Und das ist dieser Tage der utopische Teil.
Vor dem Ukraine-Krieg sind Bahnfans aus Westeuropa bis an den Pazifik gefahren. Geht das auch jetzt noch, wo Russland nicht mehr bereisbar ist und im Fernverkehrsnetz ein nie da gewesenes Loch klafft? Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte es erfahren. Noch einmal den Gleisen vertrauen und erleben, wie weit sie mich bringen. Die ZEIT druckt in den kommenden Wochen das Tagebuch meiner Reise, jede Woche erscheint eine neue Folge. Dies hier ist der erste Teil, heimgeschickt von unterwegs.
Hamburg, im Frühjahr 2023
Ich beuge mich über Landkarten, Fahrpläne und Erfahrungsberichte. Doch, man kann Russland umfahren. Nur bringt einen das in andere unbehagliche Ecken. »Menschenansammlungen umgehen«, »Grenzgebiete meiden«, »willkürliche Verhaftungen«, »Entführungen von Touristen« – mit jeder Warnung des Auswärtigen Amtes merke ich mehr, wie sehr uns der Flugtourismus ans Schummeln gewöhnt hat. Risikoländer überspringen, das ist für mich diesmal nicht drin.
Ein weiteres Handicap bilden Corona-Maßnahmen. In manchen Ländern sind die noch voll im Gange. Da werden Grenzen dichtgemacht oder Gesunde für Wochen in Quarantäne gesteckt. Was die nächste Frage wäre: Bleibe ich gesund? Ich bin sechsfach gegen Covid geimpft. Aber Wochen in engen Abteilen zubringen, das fordert das Schicksal heraus. Diese Serie, das wird mir bald klar, könnte recht unschön enden.
Reisezentrum am Bahnhof Hamburg-Dammtor, ein paar Wochen später
An einem Schalter zu warten fühlt sich retro an. Wie in einer Telefonzelle stehen. Ich habe natürlich erst mal versucht, mir mein Ticket online zu buchen. Das geht aber nicht. Im Bahnwesen herrscht die Nationalstaaterei. Man hat schon Glück, wenn man herausbekommt, was so eine Verbindung ins Ausland überhaupt kostet.
»Ich hätte gern eine Fahrkarte nach Istanbul«, sage ich also zur Frau am Schalter. Das ist ja die klassische Route nach Asien. In meinen Interrailer-Tagen machten das viele: stiegen in München in den Zug, rumpelten in verqualmten Abteilen durch Österreich, Jugoslawien, Bulgarien, und zwei Tage später standen sie am Bosporus. Heute, würde man meinen, müsste das doch viel schneller gehen. Von wegen!
Die Bahnangestellte schaut erst mal an mir vorbei, als suchte sie die versteckte Kamera. Dann schüttelt sie den Kopf: »Keine Chance.« Ich versuche es anderswo und setze bescheidenere Ziele: Sofia? Oder Bukarest? Aber immer dasselbe: »Habe ich nicht im System.« – »Kann ich Ihnen nicht ausdrucken.« – »Müssen Sie mal im Internet schauen.«
Habe ich doch. Ich wollte bloß nicht glauben, was ich gefunden habe: Es gibt exakt einen Direktzug pro Woche aus Mitteleuropa in die Türkei. Er verbindet einen kleinen Ort in Kärnten mit einem etwas größeren an der türkischen Grenze und wird betrieben von, wie heißen die – Optima Tours? Oder man wählt eine ähnlich obskure Verbindung mit fünf, sechs Umstiegen in Städten, die Russe oder Gorna Orjachowiza heißen. Man braucht auch fünf, sechs Tickets dafür, die man teils nur vor Ort bekommt.
Verkehrte Welt, denke ich. Schon an das erste Ziel meiner Reise komme ich nur auf krummen Wegen, auf stählernen Trampelpfaden. Das biederste Verkehrsmittel von allen ist jetzt gut für ein Abenteuer.
Wien, 22. Mai
Dass meine Reise in Wien beginnt, hat wenig mit Musil zu tun, der lange hier lebte. Mehr damit, dass die Stadt sich zur Bahn-Metropole entwickelt hat – spätestens seit 2016, als die ÖBB von der Deutschen Bahn das Nachtzuggeschäft übernahmen und viel daraus machten. Man kommt von hier ohne Umsteigen nach Amsterdam, Warschau, Paris, nach Split oder Barcelona. Auch mochte ich nicht in Deutschland beginnen, wo aus betriebstechnischen Gründen so gar nichts am Zugfahren mehr Freude macht.
Der Wiener Hauptbahnhof hat wenig Flair; er wurde erst vor gut zehn Jahren erbaut. Doch schon der Blick auf die Abfahrtstafel macht reiselustig. Fertőszentmiklós – da muss man doch hin! Ein paar Zeilen darunter: Kiew. Dahin muss ich zum Glück nicht. Aber für die Menschen, die sich bald hier einfinden mit ihren vollgestopften Taschen, ist das bestimmt ebenfalls ein Versprechen: sicheres Geleit in ein Land, wo sonst nicht mehr viel sicher ist.
Auch mein EC fährt weit, bis nach Baia Mare. Darauf falle ich aber nicht rein. Diese Stadt liegt überhaupt nicht am Meer, sondern tief in den Karpaten. Wenn ich da abends ankäme, säße ich erst einmal fest. Bahnfahren ist wie Schachspielen: Man rechnet besser ein paar Züge voraus. Ich fahre also nur bis Budapest mit.
Pünktlich auf die Minute setzt sich mein Zug in Gang. Er ist voll mit Backpackern aus dem Westen und Rentnern aus dem Osten. Die Frau mir gegenüber im Abteil löst »Szudoku« in einem ungarischen Rätselheft, ihre Nachbarin mit den neongelben Fingernägeln döst an der Schulter ihres Mannes ein. Ein altes Liebespaar. Noch im Schlaf streichelt sie seinen Ellbogen, seine Hand ruht auf ihrem Knie.

Ich habe heute noch nichts im Magen außer dem Cocktail vorhin im Hotel. Selbst gemixt aus rosa Brausepulver und einer milchigen Brühe voller Kolibakterien. Eine Schluckimpfung, die helfen soll gegen Cholera und gemeinen Reisedurchfall. Auch das ist ein Szenario, auf das ich mich einstellen muss: »Mit dem Zug zum Pazifik, letzter Teil: Usbekistans Bahnhofsklos«.
Derart gestärkt suche ich den Speisewagen auf. Der wird von der ungarischen Bahn betrieben und ist darum sehr zu empfehlen. So steht es zumindest in einem Buch des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš. Kaum jemand gewinnt dem Bahnfahren mehr Poesie ab als er. Und es stimmt: Dieser Wagen ist kein schnödes Bordbistro. Hier gibt es einen richtigen Kellner, ein richtiges Tischtuch, eine richtige Weinkarte und, ich will nicht lügen: eine richtig schlechte Gulaschsuppe.
In der stochere ich wohl herum, als wir die Grenze nach Ungarn überqueren. Dabei hätte dieser Moment ein bisschen Achtung verdient – dass man einfach von einem Land in ein anderes gleitet. Das wird mir auf meiner Reise kein zweites Mal passieren. Freizügigkeit, ganz wörtlich genommen. Oder, wie Rudiš das sagt: »Es ist auch die Eisenbahn, die Europa zusammenhält.«
Budapest, am Nachmittag
Keleti pályaudvar – der gewaltige, stolze Ost- und Hauptbahnhof. Ich kenne ihn seit der Vorwendezeit. Damals war er noch voller Leben, eine Stadt in der Stadt. Heute erinnert er eher an das Schloss eines verarmten Adligen, der ganze Flügel verfallen lässt. Richtig voll war es hier wohl zuletzt 2015, als Tausende Flüchtlinge aus Syrien mit dem Zug nach Westen wollten, aufgehalten von Viktor Órban, dem Beschützer Europas. Auch das ist von jetzt an mein Thema: Ich fahre zum Spaß in eine Richtung, aus der andere kommen, in Not.
Über dem Portal am Haupteingang thronen drei Gipsgestalten mit Flügeln, Dreizack und Ross, wohl die Götter des Fernverkehrs. Ein Stockwerk tiefer stehen Stephenson und Watt, die Väter der Dampfeisenbahn, noch eins tiefer vier lokale VIPs. Im Erdgeschoss eine zeitgenössische Szene: Da kreisen gerade sechs Polizisten zwei herumlungernde junge Männer ein.
Ich folge einem Klang, den man hier nicht erwartet, in einen der Nebensäle. Dort sieht es aus wie in einem Palast – Marmorsäulen, Ölgemälde, goldener Stuck an den haushohen Decken. Und tatsächlich: In einer Ecke sitzt ein alter Mann und spielt konzertreif Klavier. Er wirkt in seinem lädierten Anzug, als könnte er Hilfe gebrauchen. Aber da liegt nirgends ein Hut. Die Menschen gehen an ihm vorbei, als wäre er gar nicht da. Ich möchte ihn fragen, was er hier tut. Doch auch er nimmt die Menschen nicht wahr, ganz versunken in seine Musik.
Eine Stunde später steige ich in den Nachtexpress nach Bukarest. Hier beginnt schon am hellen Tag der dunklere Teil meiner Reise. Diesen Zug kann man von keinem deutschen Bahnhof aus mehr buchen. Seine Strecke ist nicht verzeichnet in all den Coffeetable-Books über das Bahnfahren in Europa. Die Wagen wirken angeschrammelt; aus der Toilette rinnt Wasser (das hoffe ich jedenfalls).
Ich pferche meinen Rucksack unter den Sitz. Es war ein komisches Gefühl, als ich ihn zu Hause mit all diesem Zeug vollpackte: einem Waschlappen, einer Schlafanzughose, Handwaschmittel, Klopapier, sogar einem dieser Gabel-Löffel, unter Campern als Göffel bekannt. Meine Freundin hat mir Einwegspritzen aufgenötigt: »Wenn irgendein Arzt da sein Zeug auspackt, sag, du hast welche dabei!« In Briefumschlägen habe ich diverse Geldscheine versteckt: rumänische Lei, türkische Lira, sogar ein paar Yuan. Fehlt nur noch der Brustbeutel, und ich wäre zurück in meiner Interrailer-Zeit.
Dass Züge Europa zusammenhalten, kann ich seitdem bezeugen. Für meine Generation war dieser Pass nicht nur die Einladung, sich auf Gängen und Gepäcknetzen einzunisten, um Geld fürs Hostel zu sparen. Er füllte auch dieses Wort, Europa, mit Erlebnissen auf. In Wien einsteigen, in Rom aufwachen – irgendwo dazwischen Adressen austauschen mit Backpackerinnen aus Holland … Das war schon was anderes, als hinten im Ford Taunus der Eltern über den Brenner zu kriechen.
»Ticket? You give me!« Die Schlafwagenschaffnerin kommt ins Abteil, eine entschlossene Frau mit kirschrotem Haar. Wir sind zu dritt: ein Rumäne, der sich schon bald als Kunstschnarcher erweisen wird, ich und Sylvia, eine Britin, die per Interrail unterwegs ist, volle zwei Monate lang.
Wir durchqueren die Südliche Große Tiefebene, die nicht so aufregend ist, wie sie klingt. Klatschmohn am Bahndamm zählt da schon zu den Hinguckern. Sylvia will wie ich weiter nach Bulgarien, allerdings auf der Hauptroute, während ich früher umsteige. »Wann kommst du in Sofia an?«, frage ich. »So gegen acht.« – »Ich schon um sechs.« Das sind so Triumphe unter Zugfahrern.
Lőkösháza, Ungarn, am Abend
»Großer Bahnhof!«, sagte man, als Zugfahren noch etwas war. Und so einen Bahnhof bereiten sie uns, hier an der rumänischen Grenze. Eine neue Lok wird angekoppelt. Zehn Arbeiter mindestens rücken aus, um unsere Wagen zu inspizieren. Sie klopfen mit Stangen auf die Räder, machen sich Notizen, schreiten den Bahnsteig ab. Richtige Eisenbahner, denke ich, wie auch Deutschland sie mal hatte. Ich werde auf meiner Fahrt durch Osteuropa noch etliche von ihnen sehen: stolze Menschen, wichtige Menschen, bewehrt mit Schirmmützen und Kellen. Unternehmensberater würden das wahrscheinlich anders einschätzen. Aber McKinsey, das sieht man schnell, kam nicht bis Lőkösháza.
Es mag am Dämmerlicht liegen, Rumänien wirkt durchs Abteilfenster trauriger als Ungarn: Stoppelfelder, verstreute Gehöfte, Fabrikruinen oder Fabriken – im Vorbeifahren kaum zu sagen. Dann wird es Nacht. Auch wir löschen das Licht. Wenn draußen mal etwas aufscheint und ich den Vorhang beiseiteschiebe, stehen da Bahnhofschilder mit nie gehörten Namen – Lugosch, Karansebesch, Drobeta Turnu Severin … halb im Schlaf denke ich: Wie Zaubersprüche in Harry Potter.
Craiova, Rumänien, 23. Mai
Als die Schaffnerin an die Tür klopft, ist es halb fünf. Das ist der Nachteil meiner Abkürzung: ein nächtlicher Aufenthalt in der Stadt Craiova. Mein einziger Halt in Rumänien – soll ich wirklich gleich wieder verschwinden? Ich konsultiere die Reiseplattform Wikitravel: »Craiova ist geschlagen mit korrupten Beamten und Polizisten und überrannt von gesetzlosen Gangs.« Gewarnt wird weiterhin vor »500 bis 1000 herrenlosen Hunden, die sehr aggressiv werden können«.
Ich komme heil in die Pension, die ich mir herausgesucht hatte. Sie erweist sich als Eisenwarenhandlung mit ein paar behaglichen Zimmern im Hinterhof. Umpacken, duschen, zwei Stunden schlafen, dann klingelt schon wieder der Wecker.
Im Lidl auf dem Rückweg zum Bahnhof überrumpelt mich der Ort mit Herzlichkeit. Eine Frau, die amtlich am Eingang steht, verspricht, mein Gepäck zu bewachen – vor den Gangs? Oder den Hunden? Eine andere bugsiert mich an der Kasse an der Schlange vorbei. Beim Einpacken spricht ein Mann mich auf meinen Cashewkern-Riegel an. Wir plaudern so innig, wie sein Englisch und das Thema es erlauben. In letzter Minute erreiche ich meinen Zug.
Im Zug nach Bulgarien, am selben Morgen
Nun bin ich buchstäblich in der Walachei. Der Zug, der mich herausbringen soll, ist verblüffend klein. Viele der Scheiben sind angeknackst. Der Eisenbahner mir gegenüber fährt offenbar von der Nachtschicht heim. Er hat einen Plastikkanister dabei, wie man ihn für Putzmittel verwendet. Es ist aber Rotwein drin. Er nimmt einen tüchtigen Schluck. Der Schaffner trinkt nichts, er ist ja im Dienst; er verspeist bloß krümelnd sein Brötchen.
Ich fahre hier einen ziemlichen Umweg, nach Südwesten statt nach Südosten. Man muss sich das so vorstellen: Rumänien und Bulgarien sind über eine weite Strecke durch die Donau getrennt. Und über die Donau gab es bis vor zehn Jahren nur eine einzige Brücke, auf fast 500 Kilometern. Dann wurde nach langem Hin und Her mit reichlich Geld von der EU eine zweite errichtet, und auf die fahren wir zu – die Brücke Neues Europa, auch Brücke der Hoffnung genannt. Die Hoffnung war, das Nicht-EU-Land Serbien auf diese Art zu umrunden. So ist das mit Schienen: Sie werden fast immer für den Gütertransport verlegt. Reisende sind Beifang.

Erst ruckelt unser Zug durch Gärten wie die Loks im Freizeitpark. Dann wird das Grün dunkler, dichter, wir fahren in einen Wald. Zweige schaben über die Fenster, was wohl ihren Zustand erklärt. So geht das eine Stunde lang. Wenn das Gestrüpp sich mal lichtet, kommt mit Sicherheit ein Bahnhof. Und an jedem steht ein Vorsteher und bläst in seine Pfeife. Meist steht er da allein.
So etwas sieht man daheim nur noch in Kinderbüchern. Aus einer Laune heraus maile ich Herrn Moeller, einem weit gereisten ZEIT-Leser und früheren Eisenbahner. Er versteht sofort, was mich beschäftigt. Diese Leute, schreibt er, waren früher lebenswichtig. Sie mussten zum Beispiel darauf achten, dass keine Türe mehr offen stand. »Bei uns hat das nachgelassen, nach der sog. Bahnreform, bei der bahnfremde Unbefugte alles auf den Kopf gestellt haben, den Erfolg sieht man.« Die meisten Leute bei der Bahn hätten keine Ahnung mehr, wie der Betrieb funktioniert. »Worauf kann man dann stolz sein?«
Ich gelobe, nie wieder »verwunschen« zu schreiben, aber diese Strecke hat das Wort verdient. Struppige Ziegen rupfen Gras aus sonnenverbrannten Wiesen. Frauen mit Kopftüchern schlurfen über Wege, die Gott weiß wohin führen. Dann Plattenbauten, noch ein Lidl, ein Wiedersehen mit der Donau – und nach gerade mal einem Tag das vierte Land meiner Reise. Bis jetzt läuft das alles viel besser als erwartet.
Vidin, Bulgarien, am Mittag
Die Brücke Neues Europa ist gewaltig. Hier wurde wohl mehr Beton verbaut als in den zwei Kleinstädten, die sie verbindet. Sie macht bloß keine gute Werbung für das neue Europa. Auf den vier Fahrspuren neben uns stauen sich die Lastwagen. Ich kann keine Bewegung erkennen; anscheinend sind sie geparkt. Auf dem Gleis daneben verkehrt nur unsere Mini-Bahn, einmal pro Tag in jede Richtung. Und nicht einmal die bekommen sie voll.
Die Reise endet in Vidin, in einer Art Hamsterkäfig. Bahnsteig 1 ist von allen Seiten mit Eisengittern umschlossen. Offenbar will man so dafür sorgen, dass kein Gelichter aus Rumänien hier in Bulgarien einfällt. Ein strenger Blick auf meinen Pass, dann darf ich zum Fahrkartenschalter.
Hinter der Scheibe sitzt das Klischee einer osteuropäischen Schalterfrau: schleppende Gesten, strenger Blick, wohlverborgene Mütterlichkeit. Erst soll ich meinen Ausweis rüberreichen, dann schickt sie mich in den Ort, um Bargeld zu ziehen. Als das getan ist, starrt sie ein Weilchen auf den Monitor neben ihr. Und spricht zwei düstere Wörter: »No today.« Und was ist mit morgen?, frage ich. Sie tippt etwas ein: »No tomorrow.« Der Anschlusszug in die Türkei ist komplett ausgebucht. Mein ausgefeilter Reiseplan fällt in sich zusammen.
Ich trotte zurück aus der Schalterhalle in den eben noch fröhlichen Tag. Sonnenlicht bricht sich auf den Schienen. Da ist er also, mein Törleß-Bahnhof, inklusive Fremdbestimmung. Das fällt mir aber erst später ein; im Moment will ich einfach nur weg.
Von Vidin nach Sofia, am Nachmittag
Ich nehme den erstbesten Zug Richtung Osten. Über die Landschaft kann ich wenig berichten (Karst oder so, viele Steine). Ich bin zu beschäftigt damit, zwischen tausend Funklöchern meine Züge und Hotels bis Ankara umzubuchen.
So nah und doch so unerreichbar: Auf der anderen Seite der Steine zur Rechten, hinter der serbischen Grenze, verläuft die berühmteste Zugstrecke von allen. Vor 140 Jahren rollte dort der erste Orient-Express von Paris nach Konstantinopel. Vor gut 30 Jahren war ich selbst mal da unterwegs. Nicht im Luxuszug natürlich; den kenne ich auch nur noch aus der Agatha-Christie-Verfilmung. Sondern in seinem plebejischen Nachfahren, dem deutschen Istanbul-Express. Der beförderte Gastarbeiter und im Sommer uns Interrailer. Nachdem beide Zielgruppen wegbrachen und Serbien Kriegsgegner wurde, wurde die Verbindung gekappt.
»Kursbücher«, sagt Jaroslav Rudiš, »sind Weltliteratur.« Auf jeden Fall, das spüre ich gerade, sind sie politische Schriften. Was immer sich tut auf der Welt, hat auch einen Einfluss darauf, wo und wie Züge fahren. Die Route nach Istanbul hatte ihre aristokratische Ära, dann die demokratische, und was herrscht jetzt – Anarchie? Auf den Plätzen neben mir schon. Da raucht eine Frau mit Teufelchen-Tattoo seelenruhig Zigarette. Ihr gegenüber sitzt ihr Mops, würdevoll wie ein Buddha.
Etwas verstimmt erreiche ich am Abend Sofia.
Sofia, 24. Mai
Als ich gestern ankam, erschien mir die Stadt so trist wie der Himmel: beides plattenbaugrau. Heute sieht alles fröhlicher aus, und nicht nur, weil die Sonne scheint. Die Regierungsgebäude sind behängt mit Trauben von Luftballons in den Landesfarben Weiß-Grün-Rot. Im Park vor meinem Hotel geht es zu wie auf einem Jahrmarkt. Die Kellnerin im Straßencafé verrät mir, was los ist: »Wir feiern heute den Tag des Wortes!« Na denn. Ich suche mir einen Tisch im Schatten und klappe den Rechner auf. Vielleicht hat dieser Zwischenstopp ja noch sein Gutes.
Immer noch Sofia, am Abend des 25. Mai
Warum muss man immer da warten, wo Warten besonders nervt? Der Hauptbahnhof von Sofia ist ein brutalistischer Klotz mit dem Charme eines Hochbunkers. Da stehe ich nun und starre auf die Abfahrtstafel. Der Nachtzug nach Istanbul hat also Verspätung. Erst waren es fünf Minuten, dann 10, 20, 30, inzwischen sind wir bei 45. Die Angaben sind offenkundig geraten; denn gerade fährt überhaupt nichts – irgendeine Störung im Stellwerk. »Das haben wir hier ständig«, sagt ein junger Bulgare. Zustände wie in Deutschland.

Zumindest habe ich die passende Lektüre dabei: eine »Kulturgeschichte des Wartens auf Eisenbahnen« von Robin Kellermann. Ich habe sie daheim überflogen, sogar mit dem Autor telefoniert; nun aber hat sie ihren Moment.
Das Thema klingt gar nicht mehr so nerdy, wenn man die Grundlage versteht: Zeit, wie wir sie heute erleben, kam mit dem Fahrplan der Eisenbahn. Der Sonnenaufgang, die Kirchenglocke waren als Ordnungsgrößen auf einmal nichts mehr wert. Es brauchte die vom Ort gelöste, genau zu messende Zeit. Seit Züge uns unnatürlich schnell von hier nach dort befördern, tickt auch die Uhr, unentrinnbar. Höchste Eisenbahn! Vielleicht erklärt das diese ohnmächtige Wut, die Menschen empfinden, wenn ein Zug zu spät einfährt: Da hat man sich dieser maschinenhaften Taktung unterworfen – und dann lässt sie einen im Stich.
50 Minuten, dann gleich 70, kleinschrittig weiter auf 75 – wer denkt sich die Zahlen aus? Ein Schalter nach dem anderen schließt. Ich mache mich schon daran, alle umgebuchten Anschlusszüge gleich wieder zu stornieren. Von der Tafel blinkt wie zum Hohn der Schriftzug »Gute Fahrt!«. Dann, bei 95 Minuten, dürfen wir auf den Bahnsteig.
Im Nachtzug nach Istanbul, am selben Abend
TVS 2000 heißen diese Schlafwagen der türkischen Bahn, und so modern sind sie auch. Die Einrichtung sieht aus wie selbst gezimmert; die Lampe ist hinüber. Dafür habe ich ein Waschbecken, einen Kühlschrank und eine Art Wickeltisch. Ich finde es gleich urgemütlich.
Schon blöd, diese zwei Tage und zwei Stunden Verspätung. Ich wollte den Auftakt zur Serie am Bosporus beenden: Ade, Europa; Salam, Orient. Nicht hier in Искърско. Ich wollte aber auch ein Abenteuer, und das erlebe ich jetzt, kaum mehr 10.000 Kilometer von Bangkok entfernt.
Im Kühlschrank finde ich Salzstangen und Limo – genau das Richtige. Ich schaue noch ein wenig nach draußen. Bord-TV, das Abendprogramm. Den Ton dazu liefern die Räder, die über die Spalten entlang der Schienen rollen. Tatam, tatam, tatam. Herr Moeller hat mir das Fachwort verraten; es lautet »Schienenstoß«. Auf den modernen Gleisen im Westen hört man den nicht mehr oft. Wie ein Pulsschlag, denke ich jetzt. Ein Geräusch, das Ruhe verbreitet, weil es sagt: Alles in Ordnung, ich bringe dich an dein Ziel. Ich habe diesen Klang vermisst – in Sofia und überhaupt. Jetzt höre ich ihn wieder. Tatam, tatam, tatam.


Hinterlasse jetzt einen Kommentar